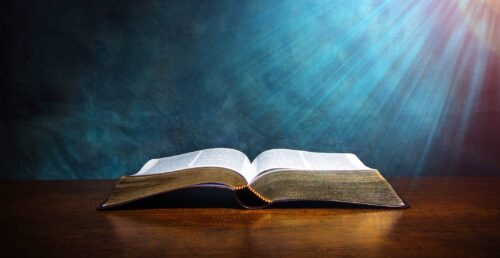„In Würzburg wurde doch schon alles gesagt!“
Diese Erinnerung hören wir Deutsche, die seit Ende 2019 auf dem Synodalen Weg unterwegs sind, häufig. Tatsächlich wurden auf der Gemeinsamen Synode der Deutschen Bistümer zwischen 1971 und 1985, 18 Beschlüsse zu vielen verschiedenen Themenkomplexen gefasst. Manches wurde umgesetzt, während anderes nach Rom delegiert wurde und bis heute unbeantwortet bleibt.
Schlägt man aber die Themen und Reformanliegen des Synodalen Wegs in der Gesamtdokumentation der Würzburger Synode nach, fällt auf, dass mitnichten schon „alles“ gesagt (und entschieden) wurde.
Ein Äquivalent zum Handlungstext „Lehramtliche Neubewertung von Homosexualität“ von Synodalforum 4 („Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“) lässt sich allein schon deshalb in den Würzburger Texten nicht finden, weil das Substantiv „Homosexualität“ auf fast 800 Seiten kein einziges Mal auftaucht.
Dem Anhang kann man zumindest entnehmen, dass in der vorgelagerten Phase der Themenfindung zum Themenkreis „Ehe und Familie“ Fragen zur „Sexualität vor und außerhalb der Ehe“ und „Homosexualität“ diskutiert wurden, aber offenbar letztlich nicht Einzug in die finalen Beratungen der Synode fanden.
Als anthropologische Voraussetzungen wurde damals postuliert:
„Es ist gut, dass es dich gibt … Eine solche Annahme ist auch nicht abhängig davon, wie der andere Mensch sich entwickelt oder was ihm widerfährt … In der sexuellen Begegnung erlangt die partnerschaftliche Liebe ihren leiblich-sinnlichen Ausdruck. Die Freude am Ehepartner, der Wille, füreinander da und in Treue verbunden zu sein, können in der sexuellen Begegnung so erfahren werden, dass diese zum Vollzug der Liebe selbst wird und die Ehe dadurch immer wieder zu ihrem Sinn findet.“
Und zur Bedeutung der Sexualität in Ehe und Familie heißt es: „Die Sexualität gehört zu den Kräften, die die Existenz des Menschen bestimmen.“
Diese nicht nur katholische, sondern gesamtgesellschaftliche Zurückhaltung in der Bundesrepublik der 1970er Jahre ist einer Diskussionskultur gewichen, die die Würzburger Überlegungen weiterdenkt. So jedenfalls verstehe ich den Synodalen Weg. Dies ist eine bewusste Ansage wieder dem katholischen Katechismus, der seit Mitte der 1970er Jahre gelebte Homosexualität kritisch, herabsetzend und mit dem Vorwurf der Sünde begegnet.
Zwischenzeitlich hat das Lehramt anerkannt, dass Homosexualität eine Orientierung ist, die nicht gewählt wird. Katholik*innen werden zunehmend zu einer kognitiven Dissonanz gedrängt, wenn sie ernsthaft versuchen wollen, offizielle Positionen der Kirche zu Homosexualität und homosexuellen Gläubigen mit der eigenen Lebenswirklichkeit in Einklang zu bringen: für Kinder und junge Menschen ist es heute völlig normal, mit queeren Identitäten unter Mischüler*innen, Lehrer*innen, Freund*innen und dem Erwachsenenumfeld konfrontiert zu werden.
So ist es nur folgerichtig, dass der „Grundtext“ des zuständigen Synodalforums – also jenem Text, der die theologische Klammer um die konkreten Handlungstexte zu Fragen von Sexualität und Partnerschaft bildet – eine klare Neujustierung fordert: „Die Anerkennung der Gleichwertigkeit und Legitimität nicht-heterosexueller Orientierungen, deren Praktiken und Beziehung, sowie im Zusammenhang die Beseitigung von Diskriminierung, die auf sexueller Orientierung basiert, ist dringend geboten.“
„Dies ist eine bewusste Ansage wieder dem katholischen Katechismus, der seit Mitte der 1970er Jahre gelebte Homosexualität kritisch, herabsetzend und mit dem Vorwurf der Sünde begegnet.“
Aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive wäre auch „längst überfällig“ eine treffliche Formulierung. Homo- und heterosexuelle Beziehungen streben nach denselben Werten und erleben dieselben Herausforderungen: Treue und Dauerhaftigkeit einerseits, Entfremdung und nachlassende Begierde andererseits.
Gelingen und Scheitern erleben alle Paare, und immer – ganz unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung – sollte die Kirche an ihrer Seite stehen, um zu unterstützen und eine Botschaft des Willkommenseins vermitteln, denn die Kirche muss den Anspruch haben, für alle Menschen Heimat zu sein. Diskriminierung und Homophobie haben dort, wo man sich geborgen fühlen will, nichts zu suchen. Weder wollen queere Christ*innen so behandelt werden, noch fühlen sich heterosexuelle Christ*innen von einer so auftretenden Kirche repräsentiert.
Eine solche Veränderung der lehramtlichen Position kann nicht in einer Ortskirche erfolgen, aber von ihr (und vielen weiteren Ortskirchen) kann (und können) ein wichtiger Impuls ausgehen. Deshalb wird die Synodalversammlung im September über einen Handlungstext beraten, der dem Papst eine Präzisierung und Neubewertung der Homosexualität empfiehlt: Jeder Mensch ist mit seiner Geschlechtlichkeit von Gott geschaffen und hat in diesem Geschaffen sein eine unantastbare Würde.

Zu jeder menschlichen Person gehört untrennbar ihre sexuelle Orientierung. Sie ist nicht selbst ausgesucht und sie ist nicht veränderbar“, heißt es im vorgeschlagenen Handlungstext. Damit, so ließe sich argumentieren, wird nachgeholt, was mit der Bibelrevision der Einheitsübersetzung von 2016 längst Einzug in das Alte Testament gefunden hat: nicht mehr „als Mann und Frau schuf er sie“, steht dort geschrieben, sondern „männlich und weiblich schuf er sie“ (Gen 1, 27). Schöpfungstheologisch wird damit markiert, dass sexuelle Identität komplexer ist als ein rein biologisches Verständnis.
#OutInChurch
Während der Synodale Weg nach seinem Selbstverständnis die systemischen Ursachen von sexuellem Missbrauch und dessen Vertuschungsapparat bearbeitet und ihnen konkrete Reformforderungen entgegensetzt, haben weitere Initiativen den Diskurs in der deutschen Ortskirche zusätzlich dynamisiert.
Besonders prominent ragt die Kampagne #outinchurch hervor, die im Januar 2022 von 125 queren Katholik*innen, die selbst im Dienst der Kirche standen oder stehen, lanciert wurde. Mittels persönlicher Testimonials und einer Fernsehdokumentation haben sie auf ihre Belange aufmerksam gemacht. Zu ihren Forderungen gehören Selbstverständlichkeiten wie diese: „Wir wollen als LGBTIQ+ Personen in der Kirche ohne Angst offen leben und arbeiten können.“
Sie prangern Diskriminierungen beim Zugang zu Handlungs- und Berufsfeldern in der Kirche, eine diffamierende Sexuallehre, den fehlenden Segen für queere Menschen und Paare und die Verweigerung von Sakramenten an und fordern die Kirche auf, sich ihrer eigenen Verantwortung und Schuld zu stellen.
Die Reaktion war immens. Die online abrufbare Dokumentation erhielt in der ersten Jahreshälfte die meisten Klicks aller Sendungen der ARD-Mediathek, auf nationaler und regionaler Ebene berichteten Medien ausführlich. Die deutsche Debattenkultur fokussierte sich schnell auf den praktischsten der Forderungen: eine Revision des kirchlichen Arbeitsrechts und eine Abschaffung der darin formulierten und besonders umstrittenen, weil fragwürdigen Loyalitätsobliegenheiten hinsichtlich der sexuellen Orientierung des eigenen Beziehungsstatus.
Ein Aspekt, mit dem längst – wohlgemerkt: informell – viele Arbeitgeber*innen gebrochen hatten und „Abweichungen“ von potentiellen Arbeitnehmer*innen schlicht ignorierten. Obgleich sich schnell eine Mehrheit der Generalvikare zu Wort meldete und das Aussetzen der Grundordnung ankündigte, steht ein rechtsverbindlicher Akt eines überarbeiteten katholischen Arbeitsrechts noch aus. Bis Herbst sollte dies der Fall sein und dann wird sich zeigen, ob alle Diözesen diese Neufassung übernehmen.
Die katholische Kirche ist direkt und indirekt weiterhin eine große Arbeitgeberin, denn für 750.000 Arbeitnehmende gilt die Grundordnung. Die Bischöfe können mit der Umsetzung also beweisen, wie wichtig ihnen die Inklusion queerer Mitarbeitender ist. Es wäre ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung und Homophobie.
Denn „Sondererlaubnisse“ und „Individuallösungen“, wie sie im Augenblick Praxis sind, sollten schnellstens abgeräumt sein. Niemand will der willkürlichen Entscheidung einzelner Vorgesetzter ausgesetzt sein und niemand sollte mit Furcht auf einen möglichen Wechsel auf Leitungsebene blicken müssen.
„Jeder Mensch ist mit seiner Geschlechtlichkeit von Gott geschaffen und hat in diesem Geschaffen sein eine unantastbare Würde.“
#OutInChurch prangert aber auch einen größeren Kontext an: 125 Gesichter ist eine beeindruckende Zahl öffentlich sich outender Menschen. Viele Menschen trauen sich diesen Schritt aber weiterhin nicht zu, weil eine Kultur des Willkommenseins fehlt und man schlichtweg nicht das Vertrauen in das berufliche oder ehrenamtliche Umfeld hat, um die eigene Identität offenzulegen.
Für diese breitere Akzeptanz genügt es nicht, Gesetze zu ändern. Hierfür ist ein Veränderungsprozess erforderlich, der verpflichtende Fortbildungen – für Arbeitnehmer*innen und -geber *innen – vorsehen muss.
Auch sollte sich die deutsche Ortskirche nicht kleiner machen als sie ist: mag sein, dass in anderen Teilen der Weltkirche eine Überprüfung der katholischen Sexuallehre nicht oberste Priorität hat. Aber ein globales Werben für Menschenrechte, um ein selbstbestimmtes Leben ohne Einschränkungen führen zu können, sollte für die deutsche Ortskirche oberste Priorität haben. Nicht grundlos ist die Arbeit unserer katholischen Hilfswerke und Aktionen eine wichtige Säule der katholischen Kirche in Deutschland.

So kann ein Beitrag geleistet werden, dass auch in anderen Ländern Homophobie und Diskriminierung als solche benannt und Auswüchse wie Konversionskurse bekämpft werden. Gerade in Ländern, deren Regierungen kirchliche Autoritäten weiterhin anerkennen, ist ein solches Signal nicht zu unterschätzen. Wir reden nicht nur über kriminelle Energie in Ländern des globalen Südens: auch EU-Mitglieder, mit denen wir eine Wertegemeinschaft bilden, diskriminieren gesetzlich und mit kirchlicher Unterstützung queere Menschen.
Hier muss die deutsche Ortskirche laut, fordernd und progressiv auftreten. Ein solcher Einsatz ist den Bischöfen schon jetzt unbenommen. Auch wenn ich überzeugt bin, dass sich die Synodalversammlung mehrheitlich für eine wie eingangs beschriebene Revision des Katechismus aussprechen wird, muss das deutsche Episkopat nicht warten, bis ein solcher Beschluss vorliegt, um aktiv auf weltkirchlicher Ebene loszulegen.
Vielfach ist davon zu hören, dass die Kirche safe spaces ermöglichen soll, wo frei von Diskriminierung und Rechtfertigungsdruck Queerness gelebt werden kann. Solche sicheren Räume können aus meiner Sicht nur ein Zwischenschritt sein: die Kirche muss insgesamt ein safe space sein, um Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten zu begegnen.
Sie sind – wie alle Christ*innen – ein Segen für die Gemeinschaft. Oder, um es mit den Worten der Würzburger Synode zu formulieren: „Es ist gut, dass es dich gibt.“
Eine Version dieses Artikels in englischer Sprache finden Sie hier.